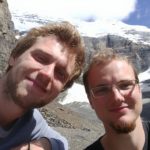Für alle, die einmal als Austauschstudierende an die University of Minnesota kommen, könnte mein Abschlussbericht aus dem Jahr 2015/2016 interessant und hilfreich sein:
Einleitung
Herzlich Willkommen an der University of Minnesota!
Dieser Bericht ist etwas länger geworden als andere, da ich versucht habe, außer meiner Erfahrungen noch alle Antworten und viele Tipps und Tricks mit einzuflechten, die mir damals beim Lesen der Erfahrungsberichte gefehlt haben. Dir als lesender Person würde ich daher empfehlen, Abschnitte zu überspringen, die für Dich nicht interessant sind. Oder erstmal einen der anderen Erfahrungsberichte zu lesen und dann hier nachzuschlagen, falls Du Dich mit einem Thema näher befassen möchtest. Frohes Lesen und viel Spaß an der U of M, Du hast wirklich Glück hierher zu kommen!
Inhalt
Einleitung
Kurz-Geschichte: lange Geschichte
Der Mittlere Westen und die “twin cities”
Wetter
Die University of Minnesota: Become a gopher!
Campus
Kurse
Studierfreundlichkeit
Möglichkeiten
Veranstaltungen, Talks, Diskussionen
Finanzielle Förderung / Stipendien
Jobs
Praktika
Wohnen: On- oder Off-Campus?
Möbel
Ankommen und sein Leben einrichten
Bank
Telefon
Health Care
Transport
Essen
Ausgehen
Rausgehen
Sport
Shopping
Ein langes Fazit
Kurz-Geschichte: lange Geschichte
Du bist Teil des ältesten Austauschprogrammes der University of Minnesota. Es wurde bereits im Jahr 1952 – von Studierenden! – gegründet. Dies kann Dir unter Umständen einen kleinen Bonus bei den ISSS (International Students and Scholar Services) einbringen, bedeutet aber gleichzeitig natürlich auch eine große Verantwortung, das Programm auch würdevoll ins nächste Jahr zu bringen 😉
Der Mittlere Westen und die “twin cities”
…sind meiner Meinung nach das “wahre” Gesicht der USA. Hier liegt historisch das industrielle Herz der Staaten, und auch heute noch ist der Midwest bekannt für eine hohe Arbeitsmoral, gute Kontakte und gute Geschäfte. Vor allem in der twin cities-Region (Also den Zwillingsstädten Minneapolis und St. Paul und Umgebung) tummeln sich viele Fortune 500-Unternehmen, es gibt eine nicht zu unterschätzende Start-Up-Kultur und immer mehr junge Menschen, vor allem Familien, zieht es aufgrund der vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten – sorry, immer noch deutlich teurer als Berlin – hierher. Mit dem Flughafen ist man sowohl zur Ost- als auch zur Westküste gut angebunden und auch zeitzonenmäßig liegt man hier ungefähr in der Mitte. Es kommt nicht von ungefähr, dass große Firmen wie Microsoft viele ihrer Standorte nach Midwest verlegen.
Freizeittechnisch gibt es hier super Angebote, in erster Linie ganz viel Natur, aber auch Sport und Shopping kommen hier nicht zu kurz, siehe dazu die jeweiligen Abschnitte. Insgesamt sind die cities eher am Tag aktiv, wer also normalerweise von Donnerstag bis Sonntag im Kater Blau abfeiert, wird in der Hinsicht hier einigermaßen ernüchtert werden (eigene Erfahrung :-().
Wetter
Davor hatten wir alle Angst: Vor der Polarkälte, die in Minnesota in meiner Vorstellung (vor Ankunft) eigentlich immer herrschte. Umso überraschter war ich dann, als ich hier bis Mitte Oktober noch in kurzer Hose herumgelaufen bin, während daheim in Berlin schon Herbst angesagt war. Durch die ultrakontinentale Lage, ist es in den cities nämlich im Sommer sehr heiß und im Winter sehr kalt und vor allem sehr wechselhaft. Temperatursprünge von >10°C von einem Tag auf den anderen sind keine Seltenheit und man gewöhnt sich schnell daran, jeden Morgen die Vorhersage zu checken, oder auch mal ganz oldschool einen Blick aus dem Fenster zu werfen.
Bis Weihnachten hat der Winter sich eigentlich kaum blicken lassen, sodass sich einige Internationals, die nur für ein Semester hier waren, schon beschwert haben, gar nichts von der crazy Kälte mitbekommen zu haben. Im Januar ging es dann doch mal auf -25°C runter und damit in den Bereich, den die Minnesotans überhaupt erst als Winter bezeichnen. Alles in den “double digits” also >10°F, zählt nämlich nicht dazu. Das ist scheißkalt. Da gewöhnt man sich auch meiner Meinung nach nicht dran. Die Kälte hielt aber nur wenige Tage an und dann wurde es wieder erträglicher. Insgesamt habe ich einen milden Winter hier erwischt, vor zwei Jahren war es deutlich länger kalt und -40°C standen angeblich auch auf dem Thermometer. Da hilft dann nur noch sehr, sehr warme Kleidung (die man hier aber auch super kaufen kann, siehe “Shopping”) und möglichst viel drinnen zu bleiben. Das ist dank eines ausgeklügelten Tunnelsystems an der Uni, dem “Gopher Way”, auf dem Campus aber auch gut möglich. Drinnen wird außerdem im Winter gut geheizt und im Sommer gut gekühlt. Manchmal auch zu gut, ich glaube fast, dass es im Winter drinnen wärmer ist, als im Sommer.
Die University of Minnesota: Become a gopher!
Campus
Der Campus der U of M Minneapolis ist ziemlich cool zwischen den beiden Downtowns der twin cities und direkt am Mississippi gelegen. Der größere Teil erstreckt sich auf der East Bank, hier sind die meisten Naturwissenschaften ansässig, außerdem das Northrop Auditorium, in dem die ganz großen Events stattfinden, die meisten Sportanlagen (das TCF Bank Stadium für Football ist nur das größte davon) und die Coffman Memorial Union, wo es Essen, University Clubs und eine überlebensgroße Statue von Goldy Gopher, dem Maskottchen der Uni, gibt.
Über die unieigene Brücke, in deren überdachtem Teil man entlang der Wände Informationen über viele der University Clubs findet, kommt man zum kleineren Teil der West Bank. Hier sitzen die unter anderem die Business School, die Law School, die Social Sciences und Theater- und Filmstudiengänge.
Es gibt auch einen St. Paul Campus, den Du gesehen haben solltest: Es riecht zwar ein bisschen nach Stall, weil dort neben Nachhaltigkeitsstudiengänngen und Biologie alle Ernährungswissenschaften angesiedelt sind und ihre eigenen Ställe betreiben (und etwas weiter entfernt auch Felder), aber die großzügigen Grünflächen sind besonders im Frühling/Sommer/Herbst ziemlich amazing. Mittwochs wird von den Studenten hergestelltes Eis verkauft. Im Spätsommer steigt nebenan auf dem Messegelände die sehr amerikanische Minnesota State Fair. Insgesamt ist der auf einem Hügel liegende Campus definitiv einen Besuch wert, auch wenn Du selber hier keine Kurse hast.
Die U of M hat außerdem noch “Außenstellen” in Duluth, Morris und Rochester.
Kurse
Das Kursangebot ist hier wirklich riesig und zum Teil ziemlich ausgefallen. Wenn Du Glück hast, kannst Du Dich in alle möglichen Kurse einschreiben, darunter viel fachlich Gutes aber auch anderes cooles von Bowling, über SCUBA diving bis wine tasting. Viele Kurse haben prerequisites, aber nach meiner Erfahrung lohnt es sich immer, einfach mal beim Professor anzuklopfen, seine Motivation darzulegen und nachzufragen, ob man nicht auch ohne mitmachen kann. Ich würde sagen: Wenn Du Dir den Kurs zutraust, sollte er für Dich auch machbar sein.
Insgesamt musst Du mindestens 12 credits belegen, um als Vollzeitstudent Deinen Status zu behalten. Unter uns internationals wurde spekuliert, was passieren würde, wenn man nur weniger als 12 credits besteht (also z.B. 14 wählt, aber einen 4-credit-Kurs mit F abschließt, was an sich schon super schwierig ist, siehe “Studierfreundlichkeit”). Vermutlich gar nichts. Ausprobiert haben wir es trotzdem nicht, 12 credits ist wirklich machbar. Ich habe im fall term, meinem ersten Semester 14 credits belegt und im spring term dann 16 und habe auch alle relativ locker bestanden. Ich hatte in beiden Semestern immer mal wieder ganz gut zu tun, musste aber andererseits fast nie absagen, wenn es in den Nächten von Donnerstag bis Samstag feiern ging.
Studierfreundlichkeit
Ich war an der business school “Carlson” und die Kurse hier sollen im Vergleich zu anderen Colleges schwierig sein. Meiner Meinung nach ist es zwar deutlich mehr kontinuierliche Arbeit als in D, also nach einer Woche Blaumachen muss man schon ein wenig ranklotzen, um in der nächsten Woche wieder auf dem aktuellen Stand zu sein. Wenn man am Ball bleibt, und immer alle assignments einreicht, bekommt man aber easy gute Noten. Also leichter als an der FU (wenigstens für BWL). Pro Stunde Aufwand bekommt man also sozusagen „gleichviel Note“, würde ich sagen. Im Unterschied zu manchen Kursen an der FU habe ich hier das Gefühl, dass die Profs wirklich Wert darauf legen, dass jede/-r bei ihnen im Kurs am Ende auch was gelernt hat. Die Profs haben in der Regel viel Verständnis für die Schwierigkeiten, die das Dasein als Austauschstudent so mitbringt und es kann Wunder wirken, sich in der ersten Woche einmal freundlich vorzustellen.
Möglichkeiten
Veranstaltungen, Talks, Diskussionen
Die University of Minnesota bietet allein durch ihre Größe viele fantastische Möglichkeiten. Zig Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen finden hier beinahe täglich statt. Diese sind zum größten Teil kostenlos, aber nicht immer ganz leicht zu finden. Um auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich Dir, Dich mit Deiner UMN-Emailadresse in möglichst viele Newsletter und Email-Listen einzutragen. Viele Email-Listen zum Eintragen findest Du bei den Kennenlernevents in der Welcome Week. Besonders ein großes Event am Jahresanfang in der Mariucci-Arena, bei dem sich zig studentische Clubs und Initiativen vorgestellt haben, war dafür gut (den genauen Namen des Events habe ich leider vergessen). Für studentische Events ist natürlich auch Facebook eine wichtige Anlaufstelle.
Einige meiner Highlight-Veranstaltungen waren ein Feature mit MPR (Minnesota Public Radio) über Rassismus und die hier sehr starke Bewegung Black Lives Matter, eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der US-Außenpolitik und eine Rede über disruptive Innovation plus Q&A mit Antonio Gracias (Investor in Tesla, SpaceX, Paypal u.a. und Busenfreund von Elon Musk). Eher enttäuscht war ich vom TEDx-Event an der Uni.
Ich kann nur raten, an so vielen interessanten Veranstaltungen wie möglich teilzunehmen, meistens ist nur eine schnelle Registrierung erforderlich, die Zeit ist fast nie vergeudet und free food gibt es oftmals auch noch.
Finanzielle Förderung / Stipendien
Weiterhin bietet die UMN auch viele Möglichkeiten der finanziellen Förderung. Studiengebühren (besonders so lange andere sie bezahlen), sind also doch nicht nur schlecht. Zum Beispiel werden Teilstipendien für Bewohner/-innen der dorms in der Form von Gebührennachlass vergeben. Außerdem gibt es Stipendien und financial aid für die, die es nachweislich gebrauchen können. Viele der Programme schließen Dich als internationalen Studierenden aus, aber hör Dich einfach mal um, für manche bist Du vielleicht doch “eligible”. Außerdem gibt es immer mal wieder Wettbewerbe, bei denen es Preise zu gewinnen gibt (jedenfalls an der Carlson School in aller Regelmäßigkeit).
Jobs
Mit Deinem J1-Visum darfst Du “on-campus” unter bestimmten Bedingungen (hauptsächlich Arbeitszeitbegrenzung) arbeiten. Natürlich kannst Du in einem Forschungsprojekt oder als TA arbeiten. Da ist es evtl. aber nicht ganz einfach dranzukommen, gerade im ersten Semester im Ausland. Es gibt aber auch zig nicht-akademische Jobs an der Uni, vom Barista im Starbuck’s über die Aufpasserin im PC-Pool (erfahrungsgemäß eine sehr, sehr unanstrengende Arbeit) bis hin zur Reinigungskraft in den dorms. Auf alle diese Jobs kannst Du Dich relativ einfach bewerben und auch relativ einfach ein Jobangebot bekommen. Nachdem der ganze Papierkram erledigt ist (besonders die Geschichte mit der Social Security Number war bei mir ein ziemlicher Hustle – generell gilt: Bring am besten immer überall ALLE Deine Dokumente mit und weise die oft nicht supergut informierten Mitarbeiter/-innen der öffentlichen Verwaltung darauf hin, wie es Deiner Meinung nach doch klappt mit dem Antrag), kannst Du mit solch einem Job easy 10$-12$ pro Stunde dazuverdienen.
Praktika
Zumindest für business-Studierende ist es das Normalste der Welt, einen Teil des Sommers mit einem Praktikum zu verbringen. Das Angebot für die mehrwöchigen Programme ist groß und quer durch alle Unternehmensgrößen und auch Gehaltsstrukturen (unbezahlt bis zu durchschnittlich 6.800$/Monat bei den großen Techies im Silicon Valley). Viele Firmen interessieren sich leider kaum für die Studentin aus Deutschland, da man ja höchstwahrscheinlich nicht nach dem Abschluss anfängt, in Vollzeit für sie zu arbeiten. Versuchen kann man es trotzdem, Bewerbungen sind in der Regel ungefähr zum Jahreswechsel fällig. Am Anfang habe ich versucht, möglichst viele Gastredner in den verschiedenen Clubs (bei mir waren das hauptsächlich SAFA und AMA) anzuquatschen. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die meisten Unternehmen auch keine Lust haben, sich mit Steuern und Abgaben, Visa etc.pp. genauer zu beschäftigen.
Ich habe dann das Glück gehabt, über ein Praktikumsprogramm der UMN (genauer gesagt des Gary S. Holmes Center for Entrepreneurship, eine Art Leuchtturm-Sub-Organisation innerhalb der Business School) an ein Praktikum gekommen zu sein. Das „Deluxe E-ternship“ vermittelt jede Jahr ca. 40 Studierende aller Studienrichtungen an lokale Start-Ups und es ist mit $12/Stunde relativ gut bezahlt. Die Programm-Verantwortlichen wussten erstmal auch nicht so genau, ob ich mich als international überhaupt bewerben kann, es kam aber relativ schnell heraus, dass eigentlich nichts dagegen spricht. Ich musste zwar etwas mehr Papierkram erledigen, als die US-Bewerber/-innen (u.a. Social Security Number beantragen, tax treaty abschließen), aber dann ging alles gut. Beworben habe ich mich glaube ich im Spät-Oktober, im Januar ging es dann los mit ~10 Stunden pro Woche. Das Coole hierbei ist natürlich, dass im Vergleich zu den oben beschriebenen Jobs auch viel wertvolles Lernen dabei ist. Ich habe in einer kleinen IT-Consulting-Firma gearbeitet und sehr viel mitgenommen.
Nach Ende des Semesters konnte ich mit denen auch noch mein J-1 Visum über den Sommer verlängern und für ein etwas höheres Gehalt weiter mit meinem Chef zusammenarbeiten. Es gibt aber sicherlich auch außerhalb des Holmes Center eine Menge Leute an der Uni, die dafür bezahlt werden, beim Finden von Praktika zu helfen. Ein Besuch in der Sprechstunde der Verantwortlichen am Fachbereich lohnt sich bestimmt.
Wohnen: On- oder Off-Campus?
Das Thema Wohnen brennt natürlich allen zukünftigen Austauschstudenten/-innen unter den Nägeln. Vorab: Lass Dich von der U of M nicht stressen (Ich weiß, sie fragen SEHR oft nach, ob Du WIRKLICH nicht auf dem Campus wohnen möchtest), meiner Meinung nach können die einen im Notfall aber immer noch irgendwo unterbringen und etliche Wohnheimzimmer standen leer, während ich hier war, vor allem die teureren im University Village waren nie komplett ausgebucht.
Ich bin ein bisschen Risiko eingegangen und habe über die U of M für $23/Nacht temporary housing (mehr Infos hier: https://www.housing.umn.edu/international) für meine ersten 10 Tage gebucht. Da wird man dann über den Sommer in ein Zimmer in den dorms gesteckt, welches zu Beginn des Semesters aber von jemand anderem bezogen wird. Diese Option existiert folglich immer nur bis Semesterbeginn und dann muss man ausziehen.
In diesen 10 Tagen habe ich mich dann hier auf die Wohnungssuche gemacht. Das war erst ein bisschen ernüchternd, weil die Mieten wirklich deutlich höher liegen als in Berlin. Sobald Du Dich darauf eingestellt hast, dass Du wahrscheinlich mindestens $500/Monat für ein eigenes Zimmer bezahlen musst, ist der Wohnungsmarkt aber sehr lebendig: Es gibt die residence halls / dorms, also Studiwohnheime auf dem Campus, mit verschiedensten Optionen zu Zimmergröße und Privatsphäre, angefangen bei geteiltem Zimmer mit Toilette auf dem Flur (Middlebrook Hall) bis hin zu 4-Zimmer-Appartments mit Einzelzimmern und einem Bad je 2 Personen (University Village, kurz UV, ca. $850 monatlich).
Die dorms bieten nur Platz für ca. 7.000 Studierende und als irgendein BWLer mal nachgerechnet hat, ist ihm aufgefallen, dass damit noch 23.000 Studis nach privaten Wohnungen suchen müssen. In den letzten 15 Jahren sind dann hier ganz schnell ganz viele Appartments von privaten Anbietern hochgezogen worden, die preislich nicht unbedingt weit über dem UV liegen, sich aber mit spektakulären “amenities” gegenseitig überbieten: Fast alle haben Gemeinschaftsräume zum Internetnutzen, Studieren oder gemeinsam abhängen, einige haben gar Heimkinos (The Knoll), riesige Balkone (FloCo), oder Riesen-Whripools im Garten (Radius).
Naja und dann gibt es noch Studierendenkooperativen, ganz normale Häuser, WGs und alles, was man aus Berlin so kennt. Die Suche für diese im letzten Satz genannten Möglichkeiten lässt sich vor allem aus Deutschland etwas unbequemer an. Craigslist und die Facebook-Gruppe “Housing” (geschlossene Gruppe, aber Beitrittsanfragen werden in der Regel schnell beantwortet) sind gute Anlaufstellen. Auch hier rangieren Preis und Qualität zwischen gut und böse. Manche wollen Dir einen fensterlosen, mit Vorhang statt Tür ausgestatteten Kellerraum in Como für $450/Monat andrehen. Mach’s nicht! Lass Dich nicht entmutigen, es gibt auch vernünftige Angebote! Ich habe hier nach einigen Tagen einen guten Deal gefunden und lebe in einem großen eigenen Zimmer in einem shared house in Dinkytown (4th Street and 11th Ave SE), zahle dafür $465/Monat und habe eine Vertragslaufzeit von 9 Monaten rausgehandelt. Normalerweise versuchen die Vermieter, für 12 Monate zu vermieten. Ich würde von solchen Mietverträgen absehen, besonders für den Sommer ist es extrem schwierig, einen Untermieter zu finden und am Ende bleibst Du so evtl. auf den 3 Monaten Miete sitzen.
Den Mietvertrag würde ich wenigstens mal überfliegen, bevor ich unterschreibe. Gerade mit Kaution und Haftung kann sich das ein wenig vom Gewohnten unterscheiden. Ich bin damals mit meinem Mietvertrag zu den student legal services der U geeiert und hab da eine Rechtsanwältin draufgucken lassen (ist kostenlos). War jetzt ganz ehrlich gesagt aber auch keine riesige Hilfe. Hab dann mit einem minimal mulmigen Gefühl im Bauch unterschrieben und bin sehr glücklich mit meiner Wahl gewesen.
Letztendlich würde ich folgende Empfehlung aussprechen: Zieh in das University Village, wenn Du nur ein Semester bleibst. Der Altersdurchschnitt ist da etwas höher und der Kotzende-Menschen-auf-dem-Flur-pro-Woche-Durchschnitt ist dort niedriger als in den anderen dorms (v.a. im berühmt-berüchtigten “Super-block”: Frontier Hall, Territorial Hall, Centennial Hall, Pioneer Hall). Außerdem ist das meines Wissens das einzige Wohnheim, in dem Du keinen meal plan (also mindestens 4 mal Mensa in der Woche) kaufen musst. Du wirst dort mit vielen internationals zusammenleben, schnell Freunde finden und Kurzzeitmietverträge sind kein Problem.
Wenn Du länger bleibst, versuch auf jeden Fall etwas off-campus zu finden. Es gibt viele Optionen, es ist oft günstiger und in meinem Fall war es sogar noch deutlich besser gelegen. Wenn Du off-campus suchst, schau in den Bezirken Dinkytown (DAS Studierendenviertel, wo auch nachts was geht) und evtl. noch Como – wobei das im Winter schon ätzend sein kann, wenn es zu kalt zum Fahrradfahren ist und der Bus nur alle 20 Minuten und nachts gar nicht mehr fährt – und achte darauf, dass Du ein Wohnzimmer hast (gegen die soziale Isolation). Lass Dich nicht von der University stressen, sondern entscheide in Ruhe, wie gesagt, im Notfall finden die bestimmt noch ein Zimmer für Dich!
Zum Schluss noch ein evtl. hilfreicher Link: https://housing.umn.edu/international
Möbel
Wer nicht in die dorms zieht – und selbst wer doch teilweise auch -, braucht Kram: Bettwäsche, Küchenutensilien, Möbel u.v.m. Hierfür kann ich stark das ReUse-Program der U und deren Warehouse empfehlen. Dort gibt es all das sehr günstig oder sogar gratis aus zweiter Hand. Allerdings solltest Du schnell sein, die besten Sachen sind kurz nach der Eröffnung zu Semesterstart vergriffen.
Ankommen und sein Leben einrichten
Ich würde Dir empfehlen, mit ein paar Tagen Pufferzeit in Minneapolis anzukommen. Ich persönlich bin schon 10 Tage vor Beginn der Orientierungstage gelandet und hatte so Zeit, mich in Ruhe mit der Wohnungssuche zu beschäftigen, ein paar Dinge zu erledigen (Bank, Telefon) und auch schon ein paar Leute kennenzulernen. Für diese Zeit habe ich das temporary housing Angebot der U of M genutzt, siehe “Wohnen”. Dadurch hatte ich danach ganz entspannt Zeit, die Orientierungswoche zu genießen und jede Veranstaltung mitzumachen, während andere sich noch mit der Erledigung von Kleinkram gestresst haben.
Vom Flughafen kannst Du Dich übrigens kostenlos vom Gopher Chauffeur abholen lassen: http://www.bhs.umn.edu/peer-health-promotion/gopher-chauffeur-airport-rides.htm und lernst dabei schon mindestens eine/-n Kommilitonin/-en kennen (mehr zum Gopher Chauffeur unter “Transport”).
Wenn Du mit Familienmitgliedern anreist, kannst Du diese für ein paar Nächte z.B. ins Commons Hotel (http://www.commonshotel.com/) welches auf dem Campus liegt, einbuchen. Günstiger geht es aber vermutlich mit AirBnB, jede Unterkunft in Up-, Dinky-, oder Downtown tut es im Prinzip auch.
Als nächstes solltest Du Dich um ein paar Kleinigkeiten kümmern.
Bank
Selbst wenn Du nur ein Semester bleibst: Du wirst ein US-Bankkonto haben wollen. Nicht nur, dass überall mit Kreditkarte oder gar Schecks bezahlt wird, für die man jeweils ein US-Konto braucht, auch für praktische FinTech Apps wie z.B. venmo, über die hier quasi jede Schuld unter Kommilitonen beglichen wird, brauchst Du es. Außerdem ist es damit deutlich einfacher, Geld an die Uni zu zahlen (selten, z.B. falls Du einen Kurs mit Extra-Gebühr für Material oder Reise buchst) oder Geld von der Uni zu erhalten (z.B. für einen On-Campus Job).
Auf dem Campus vertreten sind die TCF Bank und die US Bank. Einen Account für Studierende zu eröffnen, geht bei beiden relativ easy, wenn man alle Dokumente zur Hand hat. Ich habe mich für die US Bank entschieden, weil diese außerhalb des Campus eine bessere Verfügbarkeit von Geldautomaten hat (v.a. auch außerhalb der twin cities – da ist TCF echt rar gesät). Beide Konten kommen ohne Kontoführungsgebühren aus. Einige meiner Freunde haben auch bei beiden ein Konto eröffnet, oder bei ganz anderen Banken wie z.B. Wells Fargo. Wenn Du auf dem Campus eröffnest, gibt es witzige Prämien, z.B. ein UMN Sweatshirt oder einen Selfie-Stick.
Um jetzt Geld auf dieses US-Konto zu bekommen, gibt es prinzipiell 3 verschiedene Möglichkeiten:
- Du verdienst in den USA Geld und bekommst es direkt auf Dein US-Konto überwiesen (direct deposit).
- Du überweist von einem EU Konto oder mit Peer Transfer Geld gegen relativ hohe Gebühren.
- Du zahlst bar (oder Schecks) am ATM (Geldautomaten) auf Dein US-Konto ein.
Ich habe stets diese dritte Möglichkeit genutzt. Dazu habe ich mir ein Konto bei der comdirect Bank angelegt (vor Abreise!), mit dessen VISA-Karte ich weltweit kostenlos Geld abheben kann (der Wechselkurs ist hierbei etwas ungünstiger als der “offizielle” Kurs, das ist aber immer noch deutlich günstiger als jede Form von Gebühren). Dann habe ich mich immer mit meinen Zwei VISA-Karten zum US bank ATM begeben, verstohlen nach links und rechts geschaut, um dann eine größere Summe (i.d.R: $500) vom comdirect-Konto abzuheben und gleich nach der Transaktion die US bank VISA-Karte einzuführen und die $$ auf das US-Konto einzuzahlen. Hat wunderbar funktioniert.
Außer der comdirect Bank gibt es noch die DKB mit einem “weltweit kostenlos Abheben”-Angebot, die Wechselkurse sind mal bei der DKB (gefühlt etwas öfter), mal bei der comdirect Bank (gefühlt etwas seltener) günstiger aber meistens max. 1% verschieden. Ein DKB Konto konnte ich sogar aus den USA eröffnen, musste mir die VISA-Karte dann allerdings von meiner WG zuhause nach Minneapolis schicken lassen. Beide Konten eignen sich übrigens auch super für Reisen in die ganze Welt.
Vergiss nicht, Dein Konto bei der USbank/TCF/Wells Fargo zu kündigen, sobald Du die USA verlässt, da sonst mit etwas Pech Gebühren dafür anfallen.
Telefon
Du wirst ganz bestimmt auch ein US-Telefon haben wollen. Seit ein paar Jahren gibt es keine Unterschiede in den sog. Frequenzbändern zwischen Europa und den USA mehr. Jedes halbwegs moderne Handy/Smartphone kann daher auch hier in den USA verwendet werden (Im Zweifel kannst Du Dich easy bei Deinem Hersteller erkundigen). Da Du ja vermutlich kürzer als 12 Monate bleiben wirst, solltest Du keinen langfristigen Mobilfunkvertrag abschließen.
Viele internationale Studierende finden sich in 4er-Gruppen bei Facebook oder in der O-Woche zusammen, um einen “family plan” abzuschließen. Der gilt dann für alle vier, beinhaltet eine US-Telefon- und SMS-Flatrate und meistens ca. 10GB monatliches Datenvolumen, die sich die beteiligten Personen teilen müssen. Bei T-Mobile ist so ein Plan wohl schon ab knapp über $100/Monat (also $25/Person) zu haben.
Ich habe mich für eine Prepaid-Option entschieden, da ich schnell ab dem ersten Tag ein Telefon brauchte (Wohnungssuche etc.) und auf die Schnelle keine 4 Personen zusammenkamen. Ich habe einen Tarif von GoSmart mobile (https://www.gosmartmobile.com/) gewählt, bei dem ich monatlich $30 “auflade” (geht automatisch, wenn im Onlineaccount so konfiguriert; wenn die automatische Aufladung deaktiviert wird, kostet das gleiche Paket $35 im Monat) und dann US-Telefon- und SMS-Flatrate sowie 4GB Datenvolumen erhalte. GoSmart Mobile läuft auch über T-Mobile als Provider. Leider ist T-Mobile hier nicht wie bei uns der Premiumanbieter und so ist deren Netzabdeckung außerhalb der Stadt und leider auch in einigen Ecken auf dem Campus etwas eingeschränkt. Mich hat das auf dem Campus nicht allzu sehr gestört, da immer überall Wi-Fi verfügbar ist. Wer ständig “Up North” campen fahren möchte [mit Ausnahme der Boundary Waters, da gibt es wirklich gar keinen Empfang. Nun soll ein Mast gebaut werden und viele protestieren dagegen, da man im Urlaub dann nicht mehr zwangsweise “disconnected” wird, was für einige den Charme vom Ganzen ausgemacht hat. Aber das ist eine andere Geschichte.], sollte sich vielleicht besser für at&t und damit bessere Netzabdeckung entscheiden.
Nach Deutschland telefonieren kann man mit diesen Verträgen von Hause aus eher nicht so gut, aber es gibt zubuchbare EU-Pakete. Ich habe einfach immer über Skype, WhatsApp, Facebook u.v.a. Google Hangouts (https://hangouts.google.com/; Kann Festnetztelefone in D für $0,01/Minute und Handys für $0,04/Minute anrufen) nach Hause telefoniert.
Health Care
Eine kleine Horrorstory und Warnung für zwischendurch: Das Gesundheitssystem ist hier deutlich teurer als in Deutschland. Über die U bist Du zwar wahrscheinlich genau wie ich krankenversichert, diese Versicherung übernimmt jedoch nur 80% der entstehenden Kosten. Das ist total okay, wenn man mal mit Bauchscherzen zum Onkel Doktor geht und einen geringen Co-Pay im zweistelligen Bereich hat. Wenn sich – wie bei mir – dann aber herausstellt, dass die Bauchschmerzen von einer Blinddarmentzündung herrühren, wird es schnell ungemütlich. Natürlich hat die Gesundheit aber oberste Priorität und so musste ich das Ding herausoperieren lassen, nachdem ich mir mit einer kostengünstigeren Antibiotika-Behandlung noch etwas Zeit bis nach den Klausuren verschafft hatte. Die Arztkosten für den gesamten Prozess summierten sich auf über $18.000! Nach einigen Abzügen und der Zahlung der Versicherung blieben noch etwas über $2000 Schulden übrig. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass die University of Minnesota mich hier finanziell unterstützt hat (es gibt einen “Notfall-Fonds” für internationale Studierende) und ich so nicht verarmt bin oder zur OP nach Deutschland fliegen musste, was aus medizinischen und administrativen Gründen echt blöd gewesen wäre.
Auch von Freunden, die aus anderen Gründen in den Emergency Room mussten, habe ich ähnliche Summen vernommen. Ein Freund der sich (natürlich komplett nüchtern) den Fuß gebrochen hat, musste nach Hause fliegen, um sich operieren zu lassen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde Euch aus schmerzlicher Eigenerfahrung empfehlen, zusätzlich zur Versicherung der US-Uni noch in Deutschland eine Reisekrankenversicherung mit 100%iger Kostendeckung für die USA abzuschließen.
Transport
Die twin cities sind die fahrradfreundlichste Stadt der USA! Das heißt im Land der dicken Karren und breiten Highways natürlich noch nicht besonders viel, wenn man europäische Standards gewohnt ist. Aber die vielen Radwege (ausschließlich für Radfahrer, ich empfehle besonders den Midtown Greenway und den Cedar Lake regional Trail) und Radstraßen (mit Vorfahrt für Radfahrer) sind schon bemerkenswert. Google Maps auf Fahrradmodus leitet Dich meistens durch diese. Nach meiner Zeit hier kann ich Dir nur wärmstens empfehlen, Dir ein Fahrrad zuzulegen. Günstige gibt es entweder bei Craigslist oder ab und zu in der uniinternen Facebookgruppe “Free and for Sale” zu kaufen, oder Du kannst Dir eines im Outdoorcenter im Rec-Center der Uni mieten. Ich habe mein Rad für das komplette Jahr für $125 gemietet (ein Semester kostete $75) und es nicht bereut. Ich bin die allermeisten Strecken hier mit dem Rad gefahren, auch als das Thermometer im Januar mal zweistellig negative Werte angenommen hat. Das Gute am Mietrad ist, dass Du mit jeglichen Problemen am Rad einfach wieder ins Rec-Center fahren kannst und die das meistens gratis, manchmal für geringe Materialkosten, reparieren. Nichtmal flicken musst Du selber.
Zum Fahrrad würde ich mir noch ein Schutzblech und Lichter besorgen (mit $30 insgesamt bist Du dabei) und mir im Bike Center “The Hub” der U of M in der SE Oak Street einen Zapper ans Vorderrad kleben lassen. Den gibt es nach Anmeldung gratis und an bestimmten Masten, die auf dem Campus verteilt sind, sammelst Du “zaps” für das Gopher Zap Programm. Wenn Du mindestens an 12 Tagen in einem Monat “gezappt” wurdest, kannst Du ganz coole Preise gewinnen. Ich habe in 5 Monaten gewonnen und so eine ordentliche Summe an Gutscheinguthaben ($10-$20 pro Gewinn, hauptsächlich für Essen) verfuttern können. Außerdem kannst Du online checken, wohin Du überall mit dem Rad gefahren bist.
Das Nahverkehrssystem ist relativ gut ausgebaut, zu Stoßzeiten fahren viele Busse überall in der Innenstadt und in die meisten Randbezirke. Die 2 lightrail Linien führen von Downtown Minneapolis über den Campus nach St. Paul (green) bzw. runter zum Flughafen und der Mall of America (blue). Ein Einzelticket kostet $2-3. Für $100/Semester kannst Du den U-Pass erwerben, der Dich alles im ÖPNV benutzen lässt. Ich habe mir ihn mir in beiden Semestern zugelegt, aber er hat sich dank Fahrrad beide Male garantiert nicht rentiert. Es gibt außerdem einen Campus-Zone-Pass, dieser ist umsonst und funktioniert auf 4 Stationen auf dem Minneapolis Campus und in den Uni-Bussen (in die kann aber auch eh jede/r einsteigen und es wird nicht kontrolliert).
Ein ziemlich cooler Service ist der “Gopher Chauffeur”, ein kostenloses Uni-Taxi, welches Dich am Wochenende abends bis 3 Uhr sicher nach Hause bringt. Achtung lange Wartezeiten, am besten 1 Stunde vorher anrufen! Gopher Chauffeur kann Dich nach voheriger Anmeldung auch am Flughafen abholen.
Neu in diesem Semester war ein kostenloser Einkaufsshuttle, welcher jeden zweiten Sonntag zwischen einigen Stationen um den Campus und einem größeren Einkaufszentrum im Norden zirkuliert.
Insgesamt konnte ich so das komplette Jahr auf ein eigenes Auto verzichten. Und wenn ich dann doch mal eines gebraucht habe, haben mir Freunde gerne eines geliehen.
Essen
Während Du Dich am Anfang noch wunderst, wer die ganzen Portionen hier aufessen soll, wirst Du Dich recht schnell umgucken und merken, dass alles eine Frage der Gewöhnung ist. Ich habe einigermaßen versucht, mich nicht all zu U.S.-amerikanisch zu ernähren, was aber teilweise zu einer Herausforderung werden kann. Selber kochen ist ein ganz guter Trick.
Falls Du einen meal plan hast: 17th Avenue Hall hat das beste Essen. Auf dem Campus war mein Favorit das Bistro West auf dem West Bank Campus (unter Humphrey’s), weil es am wenigsten Fastfood-mäßig war.
Ansonsten gibt es ständig bei allen möglichen Events free food, wodurch man ganz gut einige Mahlzeiten pro Woche ersetzen kann.
Meine Lieblings-Fastfood-Restaurants waren Blaze Pizza am Ende der Washington Avenue, Five Guys Burgers in Dinkytown und Afro Deli auf der Westbank.
An Thanksgiving gibt es natürlich Truthahn. Lass Dich am besten zu einer Familie einladen.
Ausgehen
Die twin cities haben eine große Theater-Szene. Im berühmten Guthrie gibt es immer mal wieder Last-Minute-Tickets zu studifreundlichen Preisen. Das Guthrie Theater hat außerdem eine coole Architektur und die endless bridge sowie den Amber room kann man sich auch mal unabhängig von einem Theaterstück geben.
Eines meiner persönlichen Highlights war die Aussicht vom 50. Stock des IDS Centers in Downtown. Da habe ich aber auch Glück gehabt, dass mich der Reinigungs-Atze zufällig reingelassen und umschauen lassen hat. Versuchen solltet Ihr es.
Kunst gibt es im Walker Art Center und dem angeschlossenen Sculpture Garden, oder etwas kleiner aber trotzdem fein auf dem Campus im Weisman Art Museum.
Das Gebiet rund um Fort Snelling ist ohne Auto zwar schwer zu erreichen, aber definitiv ein cooler Ausflug. Ich wurde dort von einem Mitglied der Native Community (Dakota) herumgeführt, was ziemlich beeindruckend war.
Wie schon ganz kurz weiter oben berichtet, ist das nightlife nicht die größte Stärke der twin cities. Alkohol und Alkoholausschank sind ab 21 und darauf wird wirklich geachtet D.h. auch 30-jährige werden “IDed”, wenn sie zum Mittagessen gerne ein Weinchen trinken würden. Ausweisen kann man sich oft nur mit dem Reisepass oder mit der Minnesota State ID. Ich hab diese ganz am Anfang meines Aufenthaltes für ca. $30 beantragt und konnte so meinen Pass beim Feiern gemütlich zu Hause lassen. Ein paar U21-Spanier haben angeblich auch mit gefälschten IDs ganz gute Erfahrungen gemacht.
Um zwei Uhr nachts ist hier leider Sense und die Sperrstunde wird auch wirklich fast immer eingehalten (Ausnahmen gibt es außer auf illegalen warehouse-Parties in Nord-Minneapolis nur wenn Prince stirbt. Dann wurde in der First Avenue auch mal die ganze Nacht gefeiert).
Die besten Orte für Konzerte und Feierei unterscheiden sich natürlich nach Geschmack, aber Dauerbrenner sind First Avenue für Konzerte und Clubbetrieb und die Donnerstags-Freigetränke-für-Studis-Parties im Pourhouse.
Ansonsten kann ich an dieser Stelle nur dringlich empfehlen, alle social Events in der Einführungswoche mitzumachen, so lernst Du auch schon mal einige Plätze kennen. Meine Business School hatte ein ziemlich intensives und z.T. auch trinklastiges Abendprogramm, welches die Gruppe von Anfang an schnell zusammenschweißte. Die ISSS organisieren in jedem Fall auch eine Einführungswoche für alle Fachbereiche übergreifend.
Einige Eventhighlights möchte ich noch kurz erwähnen, da ich sie empfehlenswert fand: Red Bull Crashed Ice, Zombie Pub Crawl und etliche Kleinkunstfestivals.
Außerdem ist Sport hier natürlich auch zum Angucken riesig und so habe ich mir eine Dauerkarte für das Football-Team der U, die Gophers, gekauft ($100). Auch zu beinahe allen anderen erdenklichen Sportarten gibt es Uni-Teams, der Eintritt zu den Spielen und Events ist meistens für Studierende sehr günstig oder kostenlos. Ich hab versucht, von allem etwas zu sehen und bin zum Volleyball, Eishockey und Basketball einigermaßen regelmäßig in der Halle gewesen. Die Gophers haben zwar oft verloren, die Stimmung war meistens trotzdem anständig. Höhepunkt des Sportjahres ist der Super Bowl und hier wirst Du garantiert zu mindestens einer Watch-Party eingeladen.
Rausgehen
Die unglaublich schöne Natur Minnesotas war einer der Haupt-Pull-Faktoren, die mich hergezogen haben. Im Winter ist damit außer Ski- oder Schlittenhundfahren zwar nicht viel anzufangen, aber hey, es ist ja auch eine ganze Weile lang warm, vor allem wenn Du früh im August anreist oder nach dem spring term noch ein bisschen bleibst.
Die zwei besten Arten, die Natur zu genießen, sind für mich Ausflüge Up North, entweder in eine cabin oder zum Camping.
Fast jede Familie hat hier Zugang zu einer cabin an irgendeinem See weiter nördlich und wenn Du von Freunden dorthin eingeladen wirst, solltest Du das keinesfalls ausschlagen. Ich bin in mehreren cabins gewesen und diese typische Minnesotan’sche Erfahrung war einfach genial: Mal bin ich Jetski gefahren, mal Wasserski, mal kannst Du auf Dosen schießen, mal gibt es Riesentrampoline, eigentlich immer mindestens ein Motorboot und Tubes, Kayaks und Feuerstellen. Ich habe dort immer tolle und lauschige Wochenenden verbracht, ob mit befreundeten Familien oder nur mit Freunden in meinem Alter. Meine Lieblingscabin eines Komilitonen lag am Lake Vermillion knapp vor der kanadischen Grenze und man konnte dort nicht mit dem Auto hinfahren, sondern musste zum Schluss 10km Boot fahren.
Solltest Du am Anfang noch keinen Zugang zu einer cabin haben, ist Camping eine super Sache. In State Parks kann man recht günstig campen und in meinen beiden Semestern hier haben sich ständig Gruppen aus internationalen Studierenden zusammengefunden um für ein Wochenende ein Auto zu mieten und raus zu fahren. Camping Supplies könnt Ihr im Outdoor Center der U zu echt fairen Preisen mieten. Dieses bietet auch regelmäßig organisierte Trips an, für die Du Dich einschreiben kannst.
Auch innerhalb der Stadtgrenzen gibt es draußen eine Menge zu entdecken. Einer meiner liebsten Spots war die Stone Arch Bridge, von der man tagsüber und v.a. auch nachts eine super Aussicht auf die Skyline genießen kann. Weitere coole Plätze entlang des Mississippis habe ich auf Boom Island und in Downtown St Paul entdeckt. Außerdem sind die Seen im Westen der Stadt bei schönem Wetter natürlich ein Muss (am besten hinradeln über Midtown Greenway oder Cedar Lake Regional Trail)! Mit Gruppen von internationals haben wir gerne am Bootshaus der U am Wasser abgehangen, bis uns die Polizei verscheucht hat. Wenn es ganz verrückt wurde, haben dort auch einige von uns den Mississippi durchschwommen – nicht besonders zu empfehlen, wenn Du keinen Dreck magst. In einer sternklaren Nacht trotzdem ganz romantisch.
Sport
Sport kannst Du hier natürlich nicht nur gucken, sondern auch selber machen. Besonders cool, weil einfach, fand ich die von der U organisierten Ligen im Hallensport – die sogenannten intramurals. Ich selbst habe in einem Broomball-, einem Dodgeball-, und einem Soccer-Team gespielt. Diese waren jeweils unterschiedlich zusammegesetzt, aber immer eine Mischung aus Amerikanern und internationals, und hatten auch ganz unterschiedlichen Anspruch. Broomball und Dodgeball habe ich jeweils zum ersten Mal im ersten Spiel der Saison gespielt, das war aber auch völlig in Ordnung. Im Broomball wurden wir später richtig gut und haben nur knapp die Playoffs verpasst, im Dodgeball haben wir ausschließlich ordentliche Niederlagen kassiert.
Außerdem kann ich Dir den Ski and Snowboard Club ans Herz legen. Dieser veranstaltet im Winter regelmäßig Tages-, Wochenend- und im spring break auch Wochen-Touren für Schneebrettliebhaber/-innen jeglichen Niveaus. Auch Anfänger/-innen sind hier willkommen. Einigermaßen trinkfest oder besonders gut auf Skiern solltest Du sein, wenn Du auf der Hinfahrt nach Trollhaugen im Bus oder beim “Game of G.N.A.R.” mitmachst und danach noch sicher die Piste herunterkommen willst. Insgesamt sind die nahegelegenen Skigebiete im Vergleich zu den Alpen aber ein Witz, eher bessere Hügel.
Zu guter Letzt bekommst Du als Student der University of Minnesota automatisch das ganze Semester lang kostenlosen Zugang zum University Recreation and Wellness Center. Dieses ist wirklich huge and amazing und besonders im Winter sehr nützlich. Ich bin meistens zum Schwimmen dort gewesen, aber ebensogut kannst Du dort Laufen (ist aber down by the river viiieel schöner!), Pumpen, Basketballern, Saunieren oder aus einem großen Kursangebot wählen (z.T. kostenpflichtig).
Shopping
Shopping Kings and Queens kommen in Minneapolis locker auf ihre Kosten. Ob in der ehemals weltgrößten Mall of America in Bloomington oder der Open Air Nicollet Mall in Downtown. Minnesota erhebt keine Steuern auf Kleidung und daher ist es durchaus bezahlbar und hier und da kann man auch mal ein Schnäppchen machen. Vor allem wer Angst hat, zu wenig Wintersachen eingepackt zu haben, sei beruhigt: Es gibt hier genug Gelegenheit, nachzukaufen.
Für alle, die wie ich nicht so shoppingversessen sind, kann ich Goodwill empfehlen. Die Second-Hand-Kette ist v.a. für Klamotten super gut sortiert und super günstig. Außerdem fühlte ich mich beim Einkaufen immer gut, da Goodwills Einnahmen in soziale Projekte fließen.
Ein langes Fazit
…spare ich mir an dieser Stelle. Ich glaube, es wurde deutlich, dass ich meine Zeit hier geliebt habe!