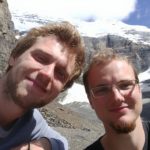[Dies ist ein sehr viel zu spät veröffentlichter Artikel zum Burning Man 2016.]
Disclaimer: Das Burning Man ist das wahrscheinlich abgedrehteste Festival der Welt. Wer wie ich zum ersten Mal dort ist, bekommt so viel Atmosphäre, Eindrücke, Erlebnisse, Erinnerungen, Farben, Formen, Klänge, Lichter, Liebe, Gespräche, Menschen, Musik, Staub, Grenzgänge und -überschreitungen, Lieder, Worte, Gefühle, Blicke, Berührungen und Erfahrungen auf Augen, Ohren, Nase, Mund, Hände, Herz, Nieren, Lunge und Leber geballert. Es ist mir schier unmöglich, selbst jetzt mit einigem Abstand, die 10 Tage in Black Rock City in Worten oder Bildern (oder auch irgendwie sonst) vollumfänglich wiederzugeben. Außerdem will ich aus verschiedensten Gründen auch vieles nicht wiedergeben. Was hier folgt, ist also nur ein ganz kleiner Ausschnitt, eine Kurzgeschichte, ein paar Spotlights, ein Mini-Erlebnisbericht und eine schöne Erinnerung für mich selbst. Sorry dafür, dass ich so viele Superlative benutzt habe, aber alles, was ich als „riesig“ bezeichnet habe, war auch wirklich riesig bis gigantomatisch, ich schwöre.
Das Festival öffnet um 0 Uhr am Sonntag seine Türen und von allen, mit denen wir vorher gesprochen haben, haben als größte Quälerei die ewig langen Schlangen bei An- und Abreise beschrieben. Wir haben ein gutes Timing, brechen am Samstag so aus Reno auf, dass wir auf der einspurigen Straße in Richtung Festival nicht in den Stau geraten und passieren die erste Greeterin um kurz nach 23 Uhr. Ein cleveres System sorgt hier dafür, dass alle fair reinkommen: Wer zu früh da ist, wird auf einem „Parkplatz“ abgestellt und dieser wird ab Gateöffnung in – Achtung, das ist der Clou – in umgekehrter Reihenfolge, also last-in-first-out, abgebaut und die Autos im Reißverschlusssystem mit in die Schlange der pünktlich ab 0 Uhr ankommenden Gäste eingefädelt. Wer also um 11.59 Uhr ankommt, ist wahrscheinlich das zweite Auto auf dem Gelände (Nach dem ersten, der nach 0 Uhr ankommt) und wer schon um 20 Uhr kommt, muss am längsten von allen Zufrühkommern warten. Zufällig sehen wir das Auto, welches in dieser Position wohl noch deutlich länger als wir wird warten müssen: Ein VW mit Deutschlandfahnen-Außenspiegelüberzügen. Deppen. Wir warten also insgesamt kaum eine Stunde und dürfen uns in dieser Zeit schon Mal auf die nächsten zehn Tage einstimmen, nämlich mit unserem ersten „Whiteout“, ein Sandsturm, der so viel Staub umherwirbelt, dass man die Hand vor Augen kaum noch sieht und mit dem Auto sowieso stehen bleiben müsste. Wir wussten, dass es staubig wird, mit dieser Menge Staub hat aber wirklich keiner von uns gerechnet! Zum Glück haben wir uns ja vorher gut ausgerüstet und so laufen wir die ersten Schritte auf der „Playa“, so wird das Wüstengelände hier gemeinhin genannt, eingepackt in Skibrillen, Staubmasken und Schals.
Wir bauen unser Zelt in den „Suburbs“ auf. Eine weitere Besonderheit des Burning Man besteht darin, dass die meisten Burner in Themen- oder Support-Camps organisiert sind und die meisten Flächen in der Stadt an diese vergeben werden. Wer keine Campzugehörigkeit hat, sucht sich – wie wir – einen Platz in den auf der Karte noch weißen Flecken zwischen den Camps. Wir finden trotzdem einen recht zentral und gut gelegenen Campingplatz und während wir unsere Zelte und Planen abspannen, treffen wir unsere zukünftigen Nachbarn, wie wir eine Vierergruppe und sehr wunderbare Menschen.
Der Sonntag besteht tagsüber darin, unser 8-Leute-Camp „Awesome Bahnhofs“ aufzubauen und Fahrräder zusammenzusetzen und zu schmücken. Die sind hier als Fortbewegungsmittel unerlässlich, muss man doch von einem Punkt der Stadt zu einem anderen öfter mal mehrere Kilometer zurücklegen. Im Gegensatz zu anderen Festivals, gibt es beim Burning Man keine getrennten Camping und Feierbereiche. Es gibt überhaupt keinen Feierbereich, da vom Festival weder Bühnen aufgebaut werden, noch DJs gebucht. Alles, also jedes Kunstwerk, jede Bühne, jedes Artcar und jedes Event sind von den Teilnehmenden des Festivals, die daher gar nicht mehr Teilnehmende im eigentlichen Sinne sind, organisiert. Es entsteht eine mehr oder weniger organisch gewachsene Stadt mit Angeboten und Camps an buchstäblich jeder Ecke. Ordnung wird nur so viel wie nötig reingebracht, indem die Straßen und Plätze abgesteckt werden und an strategischen Orten Toiletten aufgestellt. Der Aufbau der Stadt ist so einfach wie genial: Der „Man“, eine große Holzfigur, die am Samstag verbrannt wird (genau, daher der Name), steht in der Mitte. Drum herum bilden konzentrische Straßen Halbringe, deren Anfangsbuchstaben durchbuchstabiert sind. Diese werden geschnitten von radial vom Man ausgehenden Strahlen-Straßen, die je nach ihrer Lage nach einer Uhrzeit benannt sind. So erstreckt sich Black Rock City von A wie Arno bis L wie Lorenzo und von 2 Uhr bis 10 Uhr. Alles klar? Der „leere“ Platz zwischen 10 Uhr und 2 Uhr ist die sogenannte „Deep Playa“, hier stehen besonders große Kunstwerke und hier treffen sich die Fahrradfahrenden und Artcars. Wir campen bei 6:30 Uhr und H wie High Renaissance. Das Motto des Burning Man ist in diesem Jahr „Da Vinci’s Werkstatt“ und so sind die Straßennamen Verweise auf das Wirken Da Vincis und der Man ist diesmal eine 13 Meter hohe, komplizierte, drehbare, aus Holz konstruierte Statue in einem runden Rahmen, angelehnt an Da Vincis Proportionsstudien der menschlichen Anatomie. Am Man und den Straßen kann man sich immer ziemlich gut orientieren, wo in BRC man sich gerade befindet und wo es lang geht.
Am Sonntagabend ziehen wir dann endlich zum ersten Mal richtig gemeinsam los, um die Stadt zu erkunden. Die hat es in sich: Wir sind noch gar nicht weit gekommen, da stoßen wir auf eine große Rollschuhbahn, bestimmt 50m² aus Holz, mit einer im Dunkeln LED-rot leuchtenden Abbildung der Golden Gate Brücke im Hintergrund, komplett mit einer großen Auswahl an Leih-Rollerskates und typischer Rollschuhbahnmusik. Wir drehen ein paar Runden und zum ersten Mal in meinem Leben probiere ich die klassischen Rollschuhe mit 2 Rollen vorne und 2 hinten aus. Lenken ist damit viel schwieriger als mit den Inlinern, die ich von zuhause kenne. Zwischendurch genehmigen wir uns einen Drink an der Rollschuhbahnbar. Schmeckt fantastisch und wie alles ist der natürlich auch kostenlos. In Black Rock City hat Geld kaum einen Wert. Das einzige, was man hier davon kaufen kann, sind Eiswürfel für die Kühltruhen und das auch nur an 3 Stellen in der Stadt. Alles andere funktioniert nach dem zweiten der 10 Burning Man-Prinzipien: „Radical Gifting!“, es entwickelt sich eine Schenk-Wirtschaft. Jede/-r hier bringt etwas mit, das anderen ohne Gegenleistung geschenkt wird. Angefangen bei eiskalter Wassermelone (besonders an den letzten Tagen ein Genuss!) über ein Theaterstück bis hin zu den riesigen, fünfundsiebzigtausend Dollar teuren hölzernen Leuchttürmen, auf denen tagelang Menschen herumklettern und Sonnenauf- und –untergänge bewundern, bis auch dieses Kunstwerk am Samstag verbrannt wird. Alles wird von Burnern erdacht, die sich wie wir ganz normal ein Ticket für das Festival gekauft haben, finanziert, hier ins Nirgendwo transportiert und teilweise tage- oder wochenlang vorbereitet und aufgebaut. Einfach, um alle anderen glücklich zu machen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Nach der Rollschuhbahn finden wir ein Camp, in dem man Mario-Tennis auf der Wii spielen kann, sich den Controller aber vorher untenrum umbinden muss und dann mit schwingender Hüfte und dem Controller-Pimmel Aufschläge und Returns schlagen kann. Zum Schluss fahren wir eine Runde mit auf einem der „Artcars“, nicht mehr straßentaugliche, zu fahrenden Kunstwerken umgebauten Autos, meistens mit ordentlich Wumms an Bord. Wir haben stundenlang Spaß gehabt und haben unsere 6:30 Uhr Straße dabei noch kaum verlassen. Irre. Mit vom Staub verstopften Nasenlöchern, aber glücklich gehen wir am Ende dieser Nacht ins Bett.
- Unser Camp
- Baschu hat fertig
- Allee, Allee (keine Bäume)
- Tättu
- Tempel
Auf Sonntag folgen Montag, Dienstag, Mittwoch und der Crazy Ride geht genauso weiter, wie er begonnen hat. In vielen verschiedenen Camps wird zu bestimmten Zeiten Essen serviert und die Veranstaltungen haben meistens lustige Namen, bei „Meats and Beats“ legt ein DJ auf und dazu werden Briskets und Bratwürste verteilt, im Camp „Bubbles and Bass“ gibt es Champagner, es gibt grilled cheese, frozen bananas und überhaupt ist alles super lecker. Selbst wenn wir gar kein eigenes Essen mitgebracht hätten, wären wir hier super durchgefüttert worden. Ständig lernt man überall neue Leute kennen, alle sind super offen und viele sehen in ihren Kostümen unglaublich cool aus. Ich leihe mir von einem Mitte-Ende-fünfzigjährigen Pärchen ein Skateboard mit Benzinmotor aus und kann damit eine Weile über die Playa gleiten, Funfaktor 100.
Wir treffen die Jungs aus San Francisco in ihrem Camp wieder, Jim und Austin wohnen mit 100 anderen im Themencamp „Giraffes Family“, haben ihren geodesic dome aufgebaut und außerdem zwei lebensgroße, feuerspeiende Giraffen aus Metall, die das Eingangsportal des Camps bilden. Ihr weiteres Angebot an die Community besteht aus einem riesigen Klettergerüst für Erwachsene und einer an 3 Tagen geöffneten Craft-Beer-Bar. Jim hat mir den teuflischen Plan mit der Bar schon in San Francisco erklärt und der geht so: Es gibt kein Craft Beer. Auf einer 20 Biere umfassenden Bierkarte haben die Giraffen die am verhipstersten klingenden Craft Biere gesammelt und diese werden von den Barkeepern mit vollmundigen Beschreibungen angepriesen. „Circus Boy, 4,5% alc., 13 IBU“ zum Beispiel sei „ein kräftiges Hefe, gebraut in Vermont und isotononisch, also gesund.“ Oder „Yellow Snow IPA, 6,5% ABV“: „Ein recht helles lokales IPA, ein wenig hopfig im Abgang“ und so weiter… Wenn sich dann jemand eines dieser Biere bestellt, probieren die Bartender vergeblich, dieses Bier am Hahn zu zapfen und müssen sich dann entschuldigen, dieses Bier sei wohl gerade aus, man sollte doch aber unbedingt ein anderes probieren. Das andere gibt es natürlich auch nicht, „Oh, das muss gestern ausgetrunken worden sein, sorry!“ und so probieren die Anstehenden vergeblich, auch nur ein Bier von der Liste zu bestellen. Die Barkeeper fallen nicht aus ihrer Rolle, schütteln ungläubig den Kopf, fragen bei Campmitbewohnern nach, „Du sag mal, weißt Du ob es noch irgendwo ‚Copper Ale‘ gibt?“, „Hast DU vielleicht gesehen wo XY mit dem letzten Fass ‚Pliny The Elder‘ hin ist?“, laufen zum Lastwagen, kommen mit leeren Händen zurück, „Ne leider wirklich nichts mehr“ und empfehlen zwischendurch immer wieder wärmstens das „Daily Special“, welches auf einer Extra-Karte angepriesen wird und aus Bud light lime, dem wahrscheinlich uncraftiesten Bier aller Biere, besteht. Wer sich dann dazu überreden lässt, oder einfach den Überblick oder die Nerven verloren hat, bekommt eine Dose eiskaltes Limo-Bier davon. Bud light lime ist nämlich das einzige Bier, welches sie im Giraffencamp tatsächlich vorrätig haben.
Wir besuchen einen Workshop, in dem wir unsere Fahrräder ansprayen können, ich rolle fortan auf goldenen Reifen über die Playa. In einem indischen Zelt tanzen wir unter einer Sprinkleranlage, wirklich, sowas haben die Verrückten hier installiert und es ist eine bei der Mittagshitze (bis zu 40°C wird es hier tagsüber heiß, nachts aber auch wieder sehr kalt) so angenehme Erfrischung, dass wir gleich ein paar Stunden da bleiben. Fast jedes Camp hat ein paar interaktive Bereiche zum Mitmachen aufgebaut, es gibt unzählige Riesentrampoline, der Rückwärtssalto will mir leider nicht gelingen, den anderen dafür umso besser. Im Miki Beach Camp treffen wir eines Abends ein paar Hamburger, unter anderem freundet sich Floh mit einigen wirklich recht bekannten DJ-Größen aus der deutschen Szene an. Nachts zieht es uns meist raus in die Deep Playa. Die größten Artcars, „Robot Heart“ und der „Mayan Warrior“ sind auf riesige Bussen gebaut und tragen Boxen, mit denen man einen großen Berliner Club adäquat beschallen könnte. Die halbe Nacht fahren diese fahrenden Bühnen kreuz und quer über die Playa, eine Meute von einigen hundert Fahrradfahrern hinter sich herziehend. Zu einem bestimmten Zeitpunkt bleiben sie dann einfach irgendwo stehen, die Meute wirft ihre Fahrräder beiseite und innerhalb von 5 Minuten entsteht ein stattlicher Dancefloor, irgendwo in der Wüste, irgendwo im Nirgendwo. Meistens gesellen sich noch andere, kleinere Artcars dazu, steuern Lichteffekte und Chillmöglichkeiten bei. Einen besonders magischen Moment erleben wir, als diese beiden größten Artcars eines Nachts kurzerhand nebeneinander parken, sich mit einem dicken Kabel connecten und dann back to back, also immer jeweils einen Track abwechselnd, auflegen. Hat man so auch noch nicht gesehen oder gehört.
Immer wieder erleben wir fette Sandstürme, bleiben jedoch dicht zusammen und verlieren uns deswegen nie. Wir besuchen tagsüber den Tempel, ein riesiges Holzkunstwerk auf 12 Uhr in der Deep Playa. Ein sehr beeindruckendes Erlebnis, hier nehmen Burner Abschied von Verstorbenen oder begrüßen Neugeborene, alles Holz ist vollgeschrieben, mit Bildern und kleinen Gegenständen verhängt und viele Menschen sitzen andächtig in und um das Gebäude. Der Tempel brennt als letztes ab, am Sonntag, und entlässt alle Grüße, Wünsche, Entschuldigungen und Sehnsüchte, die hier ihre Manifestation gefunden haben, in den Himmel.
Gegen Ende der Woche habe ich Staub und Dreck an allen erreichbaren und unerreichbaren Stellen meines Körpers und würde wirklich gerne mal wieder duschen. Gemäß dem geflügelten Satz „The Playa provides“ bietet das Festival aber natürlich auch dafür eine Lösung. Floh und ich stellen uns beim Camp „Refoamation“ an und diese Refoamation wird dann das für mich wohl merk-würdigste (sic!) Erlebnis auf dem Burning Man: Nach langem Anstehen, das durch kleine Vorträge (Infoamation) zum Thema „Wie müssten wir Welt reformieren (bzw. refoamieren, das Wortspiel erklärt sich gleich), um sie für alle lebenswerter zu machen?“: Frauenrechte, Mitbestimmung, Legalisierung von Cannabis (mit Anschauungsmaterial) und so weiter und so fort, verkürzt wird, kommen wir in ein Zelt, in dessen Mitte ein großer Baum steht. Drumherum tanzen bestimmt 100 komplett nackte Menschen zu bouncy Tunes, die ein Hammer-DJ vom leicht erhöhten Rand auflegt. Dort am Rand, auf einem langen Podest, steht außerdem der berühmte Künstler (das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden) Alex Grey mit seiner Frau Allyson, die einzigen, die hier leicht bekleidet sind, und zusammen malen sie live ein gigantisches Wandgemälde, auf dem tanzende Skelette mit neonfarbigen, LSD-mäßigen Liniennetzen an den Köpfen verbunden sind. Das eigentliche Highlight ist aber die Booth, eine aus Plexiglaswänden und –böden gebaute Zelle, in die auf Kommando je 30-40 Nackte strömen. In einer feierlichen Prozedur wird von 6 Menschen mit Gorillamasken, die auf einem Gerüst über der Zelle stehen, die Stimmung angeheizt, bevor sie literweise Schaum (daher all die Wortspiele mit „foam“) und Wasser aus dicken Schläuchen auf die hüpfende Menge verteilen, woraufhin sich alle Beteiligten laut kreischend gegenseitig ein- und abseifen und –spülen. Ein Segen für die geschundene Haut und den ganzen Körper, feels so fresh and so clean. Wer rauskommt, tanzt sich im Zelt trocken und wird wahlweise noch von guten Feen mit Kokosnussbutter eingerieben. Floh und ich haben Glück, die allerletzte Runde für dieses Jahr miterlebt zu haben, wir können noch eine Weile tanzen und dann wird die Refoamation bis 2017 geschlossen. Wir radeln nackt und erfrischt zum Camp zurück und erzählen begeistert Jona und Basti von der eben gemachten Erfahrung, die sich nun aber leider bis zum nächsten Mal Burning Man gedulden müssen, um das auch zu erleben.
Frisch gesäubert geht es dann auch schon in die letzte Phase des Festivals, die Burns, bei denen viele der Projekte aus Holz auf wunderbare Weise verbrannt werden. Der größte Burn ist natürlich der des Mans, alle haben sich am Samstagabend hier versammelt. 70.000, die im Kreis auf die kreative Zerstörung warten. Im Außenkreis haben sich nahezu alle Artcars versammelt und zeigen noch einmal, was sie können. Der Man Burn ist spektakulär, ein großes Feuerwerk, mit großem Getöse rauschen die Flammen an den Extremitäten auf und ab, legen erst die Man Plaza, das Podest und dann den Man selbst in Schutt und Asche, begleitet vom friedlichen Wummern der Artcars und Anfeuerungsrufen aus dem Publikum; der am öftesten vernommene lautet „Let go!“. Danach tanzen die Menschen im Kreis ums Feuer, manche sammeln Nägel oder Asche wie heilige Artefakte nach einem Martyrium, manchen springen über die immer noch recht hoch lodernden Flammen und die meisten schauen einfach anmutig in die Glut.
Noch in der selben Nacht brennen auch die Leuchttürme der „Black Rock City Lighthouse Services“ ab, das größte Kunstwerk in diesem Jahr, die Flammen sind hier grün und gleißend weiß eingefärbt (Kupfer, Magnesium?) und damit fast noch beeindruckender als die beim Man. Außerdem sind viele schon abgereist und daher sitzen deutlich weniger Menschen ums Feuer, wir können aus erster Reihe zuschauen.
- Geile Nummer, ist gebucht
- Showeinlage im Distrikt von oben
- Mayan Warrior
- Robot Heart
- Fahrräder
- endlich normale Leute
- Dancen im Distrikt
- Der Man brennt
Am Sonntag herrscht große Aufbruchstimmung, wir helfen einigen sehr lieb gewonnenen Nachbarn beim Einpacken, ich treffe noch einmal die Giraffen in ihrem Camp und wir entdecken last minute, jetzt wo es weniger Angebot gibt, noch zwei neue saugeile Tanzzelte, den Cirque Gitane und das Camp Ibiza. Dort dancen wir noch ein wenig ab und begeben uns zum Tempel Burn, welcher eine ganz andere Stimmung als die voherigen Burns triggert. Hier ist alles ruhig, niemand applaudiert oder johlt, es wird wohl der Ereignisse gedacht, die vorher an den Tempelmauern niedergeschrieben wurden. Trotzdem brennt die Struktur wunderschön ab und dieser innige Moment bildet auch einen guten Schlusspunkt für dieses geile Festival.
Wir fahren am Dienstagmittag wieder vom Gelände runter, kurz bevor der Exit geschlossen wird und das war wohl wieder eine gute Idee, denn im Gegensatz zu anderen, die uns von Schlangen mit Wartezeiten bis zu 7 Stunden am Ausgang berichten, können wir wieder einfach rausfahren und müssen nirgends warten.
Das Burning Man Festival war ein riesiger Wahnsinn (bzw. Sahnwinn)! Es war so viel los, dass wir es nicht mal geschafft haben, zur halben Boeing 747, die auf der Playa zu einem Technoclub umfunktioniert wurde, zu gehen, obwohl wir dieses Projekt im Vorhinein am meisten gehyped hatten. Es war einfach nicht genug Zeit für alles da und das war auch gut so. Lange werde ich von den Erinnerungen an diese zehn Tage zehren, vieles mitnehmen und versuchen in andere Kontexte zu tragen. Ich nehme mir fürs nächste Mal einige Dinge vor – weniger Party, mehr Tagveranstaltungen besuchen, weniger Robot Heart, mehr kleine Artcars auschecken, den coolen Kaugummi-Rucksack nachbauen, den einer auf dem Rücken hatte, ein Riesentrampolin mit ins Camp nehmen, eine Schirmmütze mit dem Universum und einem Raptor auf dem Schirm basteln und solcherlei Zeugs – und lege mich damit schon fest: Ich komme auf jeden Fall wieder nach Black Rock City, sobald die Umstände es erlauben!